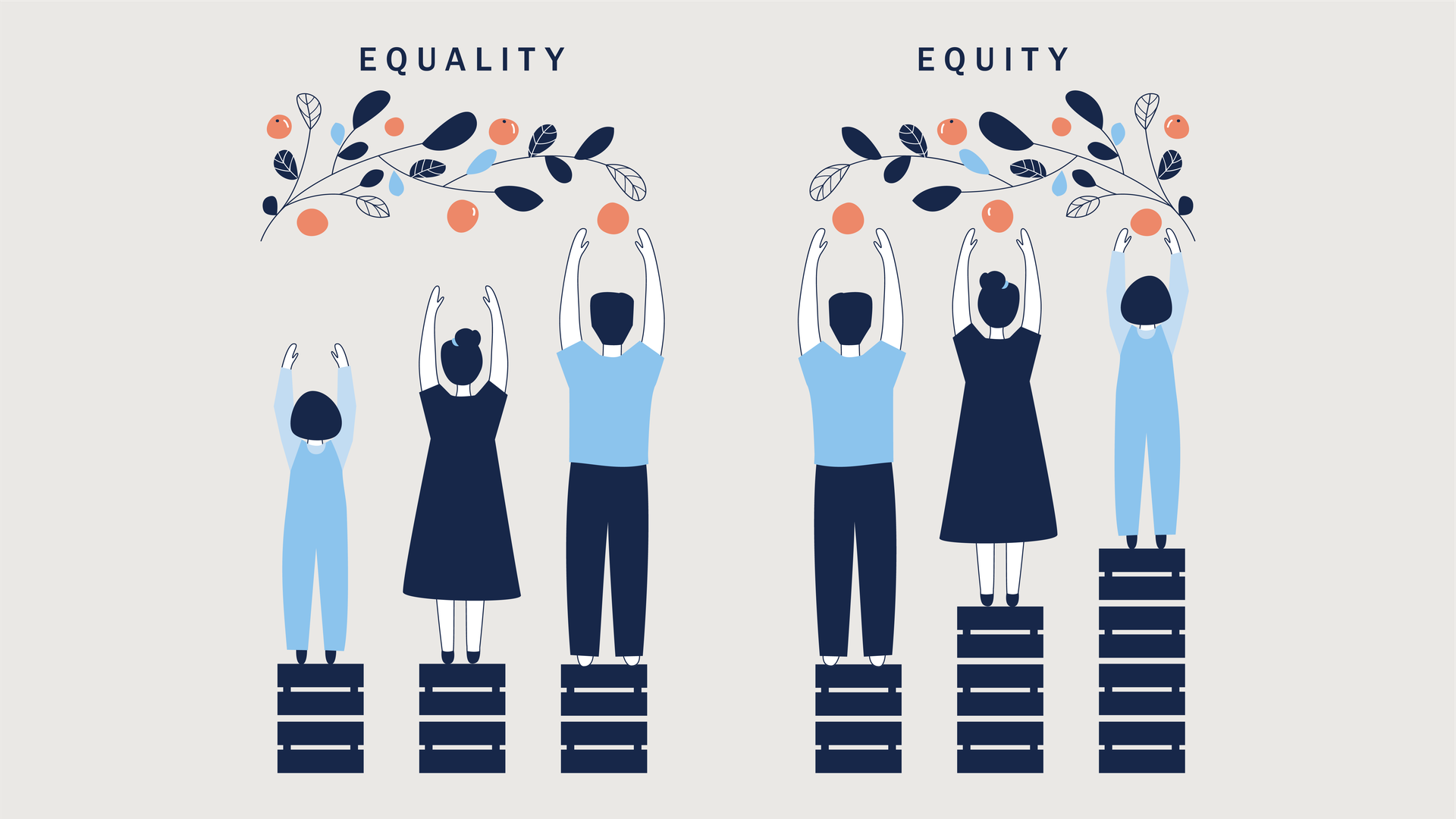Autorin: Anna Bütikofer, Leiterin Koordinationsbereich Obligatorische Schule, Kultur & Sport
Inhalts Navigation
Chancengerechtigkeit in der Bildung: Ein Rück- und Ausblick
Anna Bütikofer berichtet über erste richtungsweisende Grundsätze der Chancengerechtigkeit in der Bildung und die Arbeit einer neuen Kommission.
Chancengerechtigkeit für benachteiligte Zielgruppen
Nach Inkrafttreten des Schulkonkordats im Jahr 1970 formulierte die EDK erstmals und gleich für zwei Schulthemen Grundsätze als richtungsweisendes Instrument der kantonalen Schulpolitik. Beide Themen betreffen die Chancengerechtigkeit. Die in den 1972 erlassenen Grundsätze forderten (auch im Zuge der Einführung des Frauenstimmrechts) die interkantonale Ebene einerseits auf, jegliche Diskriminierung der Mädchen gelte es zu verhindern. Mädchen sollten dieselben Aufstiegschancen in höhere Schulen ermöglicht werden. Die Stundenpläne seien so zu gestalten, dass die typischen Mädchenfächer wie Handarbeit und Hauswirtschaftsunterricht nicht länger auf Kosten der Promotionsfächer erteilt werden.
Gleichzeitig reagierte die EDK mit den «Grundsätzen zur Schulung der Gastarbeiterkinder» auf den zunehmenden Besuch von fremdsprachigen Kindern in den öffentlichen Schulen. Verhinderung von Diskriminierung und die Gewährung gleicher Aufstiegschancen galten auch hier als oberstes Gebot. Zudem appellierte die EDK an die Kantone, die Kinder in die Schulen zu integrieren. Vermutlich eine Antwort auf die landläufig verbreitete Meinung, diese Kinder besser in eigens geschaffenen Spanisch- oder Italienisch-Schulen zu unterrichten, was auch in Kreisen der Gastarbeiter gern geteilt wurde.
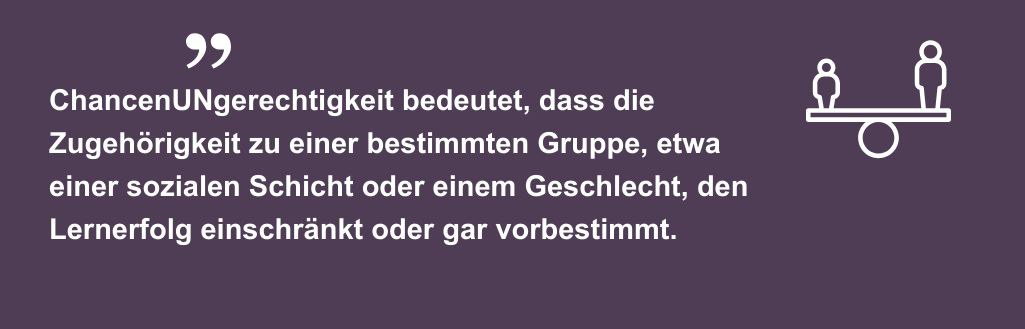
Chancengerechtigkeit als gesellschaftliche Frage
Mit der Schaffung der Kommission «Bildung und Migration» im Jahr 2004 weitete sich das Blickfeld, vom Abbau von Hindernissen für benachteiligte Kinder und der Herstellung möglichst gleicher Chancen hin zu einer gesellschaftlichen Frage. Das Mandat beauftragte die Kommission mit der Bearbeitung von schulischen und pädagogischen Belangen mit Bezug zu Sozial-, Familien- und Arbeitsmarktpolitik. Dies mitunter, weil eine Reihe von Studien, zuvorderst PISA 2000, feststellen, dass die meisten Zuwanderer in der Schweiz mehrfachen Benachteiligungen gleichzeitig ausgesetzt sind. Schon bald gerät das Thema der frühen Förderung als wichtiger Faktor bei der schulischen Integration, sowohl sprachlich wie sozial, in den Vordergrund.